«Kriminalität folgt Mustern – wir müssen sie nur frühzeitig erkennen»
Predictive Policing soll Verbrechen verhindern, bevor sie passieren – klingt nach Science-Fiction, ist aber Realität. Levi Dietrich hat sich in seiner Bachelorarbeit intensiv mit dieser Technologie beschäftigt. Er zeigt auf, wie Datenanalysen helfen können, Einbrüche vorherzusagen – und wo die Grenzen solcher Systeme liegen. Im Gespräch erklärt er, warum die Schweiz ein spannendes Testfeld ist, welche Risiken der Ansatz birgt und weshalb Datenqualität über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
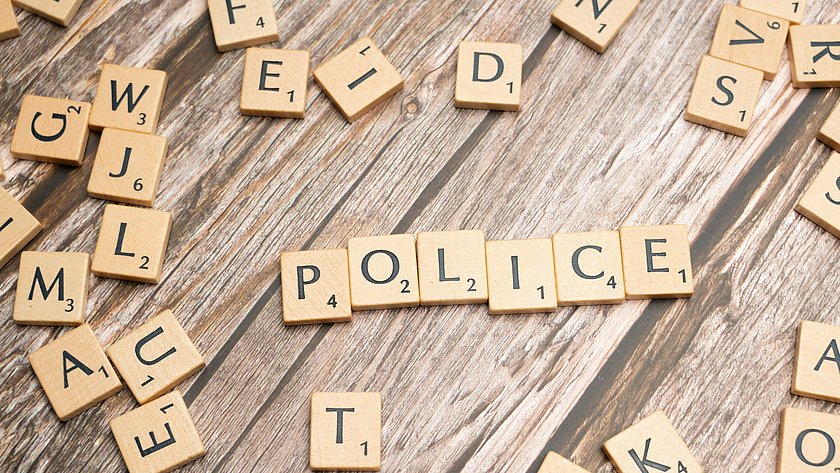
Mithilfe von Datenanalysen sollen Verbrechen erkannt und verhindert werden, bevor sie überhaupt geschehen. FFHS-Absolvent Levi Dietrich ging in seiner Bachelorthesis dieser futuristisch-utopisch anmutenden Methodik auf den Grund. (Foto: Markus Winkler)
Herr Dietrich, was hat Sie dazu bewegt, sich mit dem Thema Predictive Policing zu beschäftigen?
Das Thema vereint viele Felder: Gesellschaft, Technik, Daten, Recht und Psychologie. Es gibt bereits einige Studien, jedoch noch überschaubar und nicht spezifisch für die Schweiz.
Erklären Sie bitte kurz die Idee dahinter?
Es geht darum, Kriminalität zu prognostizieren. Man unterscheidet zwischen dem raumbezogenen Ansatz – also wann und wo Delikte wahrscheinlich sind – und dem personenbezogenen, also wer künftig schwere Straftaten begehen könnte. Letzterer wird in der Schweiz etwa im Kantonalen Bedrohungsmanagement angewandt, vor allem im Bereich häuslicher Gewalt. Im Zentrum steht jedoch die Vorhersage von Einbrüchen. Kriminalität konzentriert sich in Clustern. Nach einem Einbruch steigt das Risiko für weitere Taten in der Nähe – Täter kennen das Umfeld und schlagen oft erneut zu.
Warum ist Predictive Policing gerade in der Schweiz ein spannendes Forschungs- und Einsatzfeld?
Grundsätzlich ist es für alle Industrienationen spannend. Für meine Arbeit habe ich den Fokus auf die Schweiz gelegt – hier kenne ich den Kontext, bekomme einfacher Zugang zu Informationen und kann Besonderheiten berücksichtigen. Kriminalität folgt Mustern – wir müssen sie nur frühzeitig erkennen, und dies gilt überall.
Welche Polizeikorps oder Systeme standen in Ihrer Arbeit besonders im Fokus?
Ich habe mit der Stadtpolizei Zürich (PRECOBS) und der Kantonspolizei St. Gallen (OCTAGON) Interviews geführt – beides grosse Korps, die solche Tools nutzen.
Was unterscheidet den Einsatz in der Schweiz von Beispielen aus dem Ausland?
Die Unterschiede sind gering, vergleichbar mit Deutschland. Viele Behörden entwickeln eigene Tools. In den USA wird Predictive Policing teils auch für Delikte wie Diebstahl oder Schusswaffenkriminalität genutzt.
Was waren für Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihrer Arbeit?
Der Nutzen von Predictive Policing ist schwer messbar, die Umsetzung fehleranfällig. Es gibt keine zentrale Datenbank, das heisst Daten werden unterschiedlich gepflegt, und es ist unklar, ob Empfehlungen in der Praxis umgesetzt werden. Der Prozess ist wenig transparent, und die Einschätzungen der Behörden gehen weit auseinander.
Wo sehen Sie dennoch die grössten Chancen dieser Technologie?
Sie geht über reines Hot-Spot-Policing hinaus, da nicht nur wo, sondern auch wann Kriminalität wahrscheinlicher ist. Damit kann die Polizeiarbeit effizienter werden – denkbar für viele Formen von Massenkriminalität.
Wo müsste angesetzt werden, damit Predictive Policing funktioniert?
Grundlage sind Daten: Sie müssen zahlreich, vollständig und bereinigt sein. In kleinen Kantonen ist das kaum möglich. Viele Systeme arbeiten mit Freitext, was die Analyse erschwert. Zudem ist unklar, ob sinkende Fallzahlen tatsächlich kausal mit Predictive Policing zusammenhängen – Kriminalität wird von vielen Faktoren beeinflusst und kann sich einfach verlagern.
Und wo liegen die grössten Risiken – etwa beim Datenschutz oder bei Diskriminierung?
Der Big-Data-Ansatz steht im Widerspruch zur Datensparsamkeit. Mit Machine Learning wird es zunehmend unmöglich, Outputs nachzuvollziehen – Transparenz ist aber zentral. Diskriminierung ist in der Schweiz weniger ein Problem, da es vor allem um Einbruchprognosen geht. Kritisch ist eher der «Kontroll-Kreislauf»: Mehr Kontrollen führen zu mehr erfassten Delikten.
Wo sehen Sie die Zukunft von Predictive Policing in der Schweiz?
Momentan dominieren einfache Datenmodelle. Predictive Policing wird sich wohl etablieren und ausweiten – getrieben durch Fortschritte im maschinellen Lernen und in der KI.
